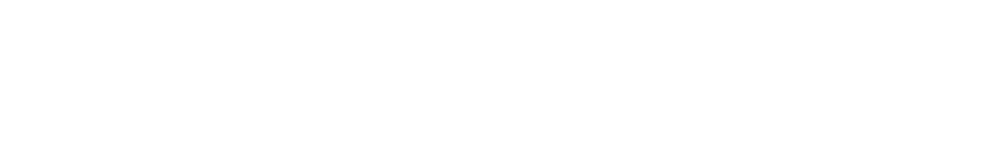| (GZ-17-2020) |
 |
Von Straßennamen und Umbenennungen |
|
Gestern hat mein Chef gesagt... Bei Straßen, die nach Antidemokraten benannt wurden, taucht die Frage nach deren Namensänderung ebenso auf, wie als Beitrag im Kampf gegen Gegenwartsrassismus. Erschweren derartige Tilgungen nicht auch die kritische Auseinandersetzung mit der dahinterstehenden Geschichte? |
|
„Straßen umzubenennen, ist eine heikle Sache. Da steht ja für die Anwohner und Besucher, für Kartendienste, für Taxifahrer, Rettungsdienste und viele andere doch einiges auf dem Spiel. Einfach ganz ohne Bürgerbeteiligung einen traditionellen Straßennamen auszulöschen, sollte eine Ausnahme bleiben.“ Mein Chef, der Bürgermeister, las gerade Berichte über die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin. Die Mohrenstraße empfanden und empfinden einige Berliner als Ärgernis, da sie Mohr als rassistisches Schimpfwort sehen. Dafür braucht man neben der richtigen Gesinnung auch fehlende Lateinkenntnisse, denn das lateinische mauros heißt einfach schwarz oder afrikanisch. Auf diesen Begriff gehen auch die Mauren zurück, die via Spanien Europa viel verloren geglaubtes Wissen der Antike aus Nordafrika zurückbrachten und auch der Heilige Mauritius, der nicht nur einer Insel im Indischen Ozean seinen Namen lieh, sondern sich auch im eingedeutschten Moritz großer Beliebtheit erfreut. Anhänger von cancel culture, deren Eltern so unsensibel waren, sie Moritz oder Maurice zu nennen, sollten also eine Umbenennung in Max in Betracht ziehen. Mit der Mohrenstraße war Berlin in einem zweifachen Dilemma, da es auch noch eine nach dieser Straße genannte U-Bahnstation gibt. Die Berliner Verkehrsbetriebe, nicht faul, suchten einfach eine andere Straße in der Gegend und wollten die Station in Glinkastraße umbenennen. Ein russischer Komponist schien ungefährlich, bis sich herausstellte, dass der namensgebende Michail Glinka ein heftiger Antisemit war. Ja, so facettenreich ist das manchmal mit den Namenspatronen. Deshalb hat die Bezirksversammlung mit den Stimmen von sich nach außen immer basisdemokratisch gebenden und auf Einbeziehung der Zivilgesellschaft drängenden Parteien beschlossen, die Mohrenstraße ohne Bürger- oder Anwohnerbeteiligung nach Anton Wilhelm Amo zu benennen. Wobei es sicher eine gute Idee ist, in Deutschland Straßen nach ihm zu benennen. Anton Wilhelm Amo wurde um 1700 im heutigen Ghana geboren und gelangte nach Amsterdam, von wo er dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel durch die Niederländisch-Westindische Gesellschaft geschenkt wurde. Der Herzog erkannte sein Talent, förderte es und ermöglichte ihm ein Studium. Somit wurde Amo der erste aus Afrika stammende Jurist und Philosoph, der im Gebiet des heutigen Deutschland ausgebildet wurde und der bis heute eine kulturelle Brücke zwischen uns und Ghana bildet. Also klar straßennamenwürdig. Das Problem mit der Umbenennung ist nur, dass Hunderte ihre Adresse ändern müssen, darunter das Bundesministerium der Justiz, sämtliche Karten in einer zentralen Gegend Berlins falsch werden und so manche Taxler oder Sankafahrer etwas brauchen werden, bis sie Fahrgäste oder Verletzte ohne Verzögerung von dort abholen können. Vor allem aber geht die Erinnerung daran verloren, dass es in deutschen Landen eben nicht nur diesen brillanten Mann mit afrikanischen Wurzeln gab, sondern eine Reihe von heute namenlosen Hofmohren, die aus Afrika verschleppt wurden, um an deutschen Fürstenhäusern, etwa am preußischen Hof, als Diener, Musiker oder schlicht als exotisches Beiwerk gehalten zu werden. Ein faszinierender Mann, der es verdient hat, in der kollektiven Erinnerung zu bleiben, verdrängt damit die Erinnerung an all die, die nicht wie er das Glück eines fürstlichen Förderers gehabt haben. Ob das tatsächlich ein Beitrag im Kampf gegen Gegenwartsrassismus ist? Mein Chef, der Bürgermeister, ist froh, in unserer Stadt keinen umstrittenen Straßennamen zu haben – oder jedenfalls keinen, dessen Zweifelhaftigkeit bisher thematisiert wurde. Denn ob bei Straßen, die nach dem kolonialen Erbe wie Togo oder Kamerun benannt sind, oder bei Straßen, die die Namen von Antidemokraten wie Ernst Thälmann oder Clara Zetkin tragen: Immer muss man abwägen, ob deren Tilgung nicht auch die kritische Auseinandersetzung mit der dahinterstehenden Geschichte eher erschwert. Denken wir an ein Wort des Journalisten Alexandre Laumonier: „Eine Irrfahrt ist keine Reise und kein Ausflug. Sie ist die Frage: Was tue ich da?“. |
|
Ihre Sabrina
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen? |