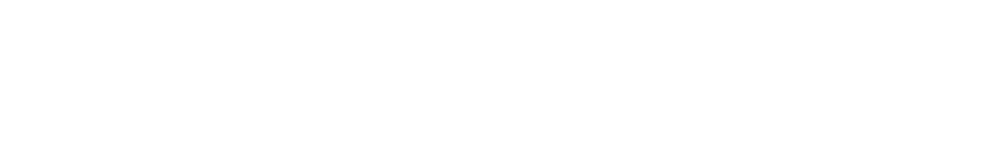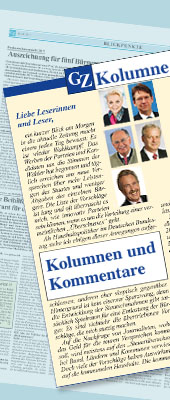| (GZ-22-2024 - 21. November) |
 |
► „Heritage Impact Assessment“: |
Windkraft im Umfeld der Wieskirche |
|
Von Thomas Wiedemann, Mediator Kanzlei Ponschab + Partner und Berater bei kommunalen Konflikten Energiewende oder Denkmalschutz? An dieser Frage scheiterte jahrelang die Errichtung von Windrädern im Umfeld der Wieskirche, die den besonderen Status eines UNESCO-Weltkulturerbes genießt. Jetzt liegt eine Studie vor, die in Einklang mit den Anforderungen der UNESCO geeignete Windkraft-Standorte auch im besonders sensiblen Umfeld der Wieskirche ausweist. Das angewendete Prüfungsverfahren gilt als wegweisend für vergleichbare Vorhaben.
Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau wollte schon 2013 die Energiewende vorantreiben und dazu vier Windräder auf dem Gemeindegebiet aufstellen. Dem standen aber die strengen Auflagen der UNESCO entgegen. Diesen Auflagen zufolge sind im Umfeld der Wieskirche als besonders geschütztem Weltkulturerbe nur Bauvorhaben zulässig, deren Unbedenklichkeit in einem besonderen Prüfverfahren, einem „Heritage Impact Assessment“, nachgewiesen wird. Angesichts der Kosten und des ungewissen Ausgangs verzichteten die Windkraft-Initiatoren, die örtliche Initiative „Bürgerwind“, auf das aufwendige Prüfverfahren und ließen das Vorhaben ruhen. Peter Ostenrieder, der 2020 neu gewählte Bürgermeister von Peiting, wollte es aber genau wissen und hat es geschafft, für die Wieskirche ein Heritage Impact Assessment zu initiieren. Wegen des Modellcharakters der Angelegenheit war das Landesamt für Denkmalpflege sogar dazu bereit, einen Großteil der Kosten zu übernehmen. Die Untersuchung fand im Rahmen eines Kommunalen Denkmalkonzepts (KDK) statt. Das ist ein Planungsinstrument, das bayerische Kommunen dabei unterstützt, die Anforderungen des Denkmalschutzes bei der Ortsentwicklung proaktiv einfließen zu lassen. Im Umfeld der Wieskirche wurde akribisch erfasst, welche Elemente – also Landschafts- und Kultur-Denkmäler – die besondere visuelle und spirituelle Wirkung der Region ausmachen, und auf welche Flächen diese Wirkung eingegrenzt werden kann. Weiter wurde anhand topographischer Daten und Begehungen ermittelt, wo Pilgerpfade zu berücksichtigen sind und wo, unabhängig davon, Sichtverbindungen zur Kirche bestehen und wo nicht - bis zu einer Bauwerks-Höhe von 240 Metern und darüber. Die Erstellung des KDK nahm über ein Jahr in Anspruch und wurde von einem „Runden Tisch“ begleitet, an dem unter anderem das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, der Landkreis, betroffene Gemeinden, Gutachter und nicht zuletzt Vertreter der UNESCO teilgenommen haben. Kommunales Denkmalkonzept Erstes Ergebnis des KDK ist eine genaue Analyse und kartographische Darstellung im Umkreis der Wieskirche, aus der hervorgeht, welche Standorte für Windräder grundsätzlich nicht in Frage kommen, welche grundsätzlich und welche bedingt geeignet sind. Die in Peiting geplanten Standorte gehören demnach zu den wenigen für Windräder gut geeigneten Flächen im Umfeld der Wieskirche. Es wird aber auch die Forderung der UNESCO nach einem Heritage Impact Assessment (HIA) bestätigt. Diese speziell auf den konkreten Standort ausgerichtete Untersuchung wurde dann auch noch im Rahmen des KDK vorgenommen, liegt inzwischen vor und ist auf peiting.de einsehbar. Diesem HIA zufolge wird das Landschaftsbild im Umfeld der Wieskirche durch die Peitinger Windräder insbesondere aufgrund der Entfernung von mehr als 10 km nicht wesentlich beeinträchtigt. Weiter sind aufgrund der topographischen Beschaffenheit nur wenige Sichtverbindungen möglich, denen allesamt eine lediglich untergeordnete Wirkung beschienen wird. Um die Auswirkungen der am geplanten Standort Peiting geplanten Windräder so gering wie möglich zu halten, wurden folgende Empfehlungen ausgesprochen:
Mit diesem Prüfungsergebnis steht den neuen Windrädern in Peiting erst mal nichts mehr im Wege und Bürgermeister Ostenrieder erwartet jetzt den Bauantrag der Initiative „Bürgerwind“. Aus seiner Sicht hat sich der Aufwand gelohnt: „Das KDK hat gezeigt, dass erneuerbare Energien auch in einer kulturell schützenswerten Umgebung, wie im Pfaffenwinkel, möglich sind. Peiting wird damit in die Lage versetzt, einen bedeutenden Anteil des eigenen Stromverbrauchs selbst auf nachhaltige Weise zu erzeugen. Und unsere Bürgerinnen und Bürger können dabei auch finanziell profitieren, da ihnen bei der Finanzierung eine Beteiligung angeboten wird.“ |
|
Thomas Wiedemann, Mediator Kanzlei Ponschab + Partner und Berater bei kommunalen Konflikten
Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen? |